Zwischen Konzentration und Isolation
Die große Selbstbelügung
Es ist keine Utopie mehr, sondern es gibt den sagenumwobenen Ort des 21. Jahrhunderts, an dem Milch und Honig fließen. Ein magischer Ort, an dem Arbeitnehmer in ausgeleierten Jogginghosen auf ihren Sofas lümmeln, während das Gehalt wie von Zauberhand auf das Konto rieselt. Zumindest existiert diese Fantasie hartnäckig in den Köpfen vieler Vorgesetzter, die sich nachts schweißgebadet aus dem Schlaf reißen, weil sie davon träumen, wie ihre Angestellten während der Arbeitszeit Mojitos schlürfen.
Arbeiten!
Als ich vor einiger Zeit meinem Nachbarn über den Gartenzaun hinweg erklärte, dass ich »von zu Hause arbeite«, zwinkerte er verschwörerisch und formte mit den Händen Anführungszeichen in der Luft. »Arbeiten«, wiederholte er mit einem Tonfall, der unmissverständlich kommunizierte: »Klar, und ich bin der Weihnachtsmann.«
Diese Reaktion ist symptomatisch für eine Gesellschaft, in der der Wert der Arbeit noch immer über ihre Sichtbarkeit definiert wird. Wenn niemand sieht, wie ich schwitzend über Exceltabellen brüte – arbeite ich dann überhaupt?
Fantasien der Chefetage
Der durchschnittliche Manager, und ich habe davon wirklich schon einige in meinem Leben kennengelernt, stellt sich das Homeoffice etwa so vor: Mitarbeiterin Müller loggt sich um 9:00 Uhr symbolisch ein, stellt ihren Status auf »beschäftigt« und verschwindet dann für den Rest des Tages in einem Paralleluniversum aus Streaming-Marathons mit spontanen Nickerchen. Zwischendurch wird, während sie ihren Nagellack auffrischt, vielleicht mal eine E-Mail beantwortet – aber nur, wenn sie wirklich nicht mehr aufzuschieben ist.
Mitarbeiter Schmidt ist auch nicht besser: Er liegt währenddessen entspannt auf seiner Couch, den Laptop geschickt so positioniert, dass die Webcam nur sein Gesicht erfasst, während er eine Heldenreise nach der anderen in seinem Lieblings-Onlinespiel durchlebt. »Die Produktivität«? Irgendwo zwischen »existiert nicht« und »homöopathisch verdünnt«.
Büro-Horrorfilme
Ich erinnere mich noch gut an meine Zeit in einem Großbüro – jener architektonischen Fehlentscheidung, die es ermöglicht, dass 30 Menschen gleichzeitig an ihren geistigen Grenzen arbeiten, während sie so tun, als würden sie die Geräuschkulisse ihrer Kollegen nicht wahrnehmen. Bei mir waren es zeitweise nur bis zu sechs Personen in einem Raum, aber das reicht auch und ist mehr als genug! Ich meine, wenn der Raum – inkl. Küchennische und Lagerbereich für das nächste große Event – nicht größer als ein Kinderzimmer ist, dann ist das schon wirklich äußerst kuschelig. Zudem war meine sportliche Betätigung täglich sichergestellt, da ich stets über irgendwelche besonders »wichtigen Requisiten« steigen musste, die liegen geblieben waren.
Und dann war da noch die eine Kollegin, ich sehe sie immer noch bildlich vor meinen Augen, deren tägliches Ritual darin bestand, erst einmal Kaffee zu kochen und die Maschine danach langatmig zu reinigen. Gerade fertig, folgten diese unvermeidlichen »kurzen Meetings«, die spontan zwischen Schreibtischen entstanden. Fünf Personen, alle positionierten sich im Kreis und diskutierten lautstark über das neue CRM-System, während ringsum alle anderen Kollegen versuchen, sich auf ihre eigene Arbeit zu konzentrieren. Und der neueste Tratsch und Klatsch machte gleichzeitig auch noch die Runde.
Die Kuchenflüsterer
Es gibt aber auch die wunderbar geselligen Kollegen, deren Lebensziel es zu sein scheint, jeden Anlass zu feiern – vom Geburtstag bis zum erfolgreichen Kauf eines neuen Toasters. »Kommt alle zur Küchennische, es gibt Kuchen!« – der Schlachtruf, der jede Konzentration im Umkreis von 10 Metern zuverlässig zerstört. Nicht ein- bis zweimal im Monat, nein, das fand so wöchentlich statt.
Mir kommt es vor als wäre das Großraumbüro im Grunde nichts anderes als ein ausgeklügeltes Folterinstrument, designt von Sadisten, die herausfinden wollten, wie viele sinnlose Unterbrechungen ein Mensch ertragen kann, bevor er seinen Laptop mit einem beherzten Wurf durch die nächste Fensterscheibe befördert.
Scheinproduktivität für Fortgeschrittene
Zum Glück habe ich es nicht selber erlebt, aber es soll einige Angestellte geben, die einen Großteil ihrer Zeit damit verbringen, beschäftigt auszusehen. Eine Kunstform, die jahrelanges Training erfordert: Das konzentrierte Starren auf den Bildschirm, während in Wirklichkeit über die nächste Urlaubsdestination nachgedacht wird. Das hektische Tippen auf der Tastatur, das einen wichtigen E-Mail-Verkehr suggerieren soll, während in Wahrheit die Einkaufsliste für den Wochenendeinkauf entsteht. Und selbstverständlich darf unbedingt auch nicht das gelegentliche, nachdenkliche Stirnrunzeln vergessen werden, das tiefgründige Gedankenprozesse symbolisieren soll, obwohl gerade nur überlegt wird, ob heute Abend Pizza oder Pasta auf dem Speiseplan stehen.
Doch all diese Techniken werden im Homeoffice obsolet. Plötzlich zählt nur noch das tatsächliche Ergebnis der Arbeit – ein revolutionäres Konzept, das manch einen Vorgesetzten in existenzielle Krisen stürzt. Denn wie soll man die Leistung bewerten, wenn man nicht sehen kann, wie lange jemand am Schreibtisch sitzt?
Big Brother im Schlafzimmer
Die Angst der Führungskräfte vor dem Kontrollverlust hat mittlerweile groteske Ausmaße angenommen. Software, die Tastaturanschläge zählt, Webcams, die in zufälligen Intervallen Fotos machen, und verpflichtende Video-Calls, bei denen jeder sein Gesicht in die Kamera halten muss wie ein Verdächtiger bei einer polizeilichen Gegenüberstellung.
Besonders kreativ sind Unternehmen, wenn es um die Überwachung ihrer heimarbeitenden Truppen geht. So gibt es tatsächlich Software, die registriert, wie oft jemand klickt oder tippt. Als wäre die Anzahl der Tastenanschläge ein verlässliches Maß für Produktivität. Nach dieser Logik wäre ein Schimpanse, der auf einer Tastatur herumhämmert, der produktivste Mitarbeiter des Monats.
Hier ist eine Passage im Stil des Originaltextes zum Unterschied zwischen Homeoffice und mobilem Arbeiten:
Homeoffice vs. Mobiles Arbeiten
Eine besonders raffinierte Strategie mancher Arbeitgeber ist die sprachliche Wortgaukelei zwischen »Homeoffice« und »Mobilem Arbeiten«. Klingt ähnlich, unterscheidet sich jedoch wie ein Feinschmeckermenü von einer Tütensuppe.
Beim echten Homeoffice stellt der Arbeitgeber theoretisch alles bereit: den ergonomischen Stuhl, den höhenverstellbaren Tisch, den Bildschirm in Augenweide-Format. Beim »Mobilen Arbeiten« hingegen heißt es plötzlich: »Sei flexibel, wo und wie du magst – wichtig sind nur die Resultate!« Eine wunderbare Ausrede, um die Kosten für die Arbeitsplatzgestaltung elegant an die Mitarbeiter auszulagern.
»Aber Sie können doch überall arbeiten!«, schwärmt der Abteilungsleiter, während er selbst in seinem vollausgestatteten Büro sitzt, das er natürlich auch zu Hause hat. Währenddessen balanciert Mitarbeiter Schmitz seinen Laptop auf einem wackeligen Beistelltisch und nutzt einen Küchenstuhl, der vermutlich aus der Studentenzeit seiner Großmutter stammt. Klar, dass nach drei Monaten »flexiblem Arbeiten« Rückenprobleme und Sehnenscheidenentzündungen zum unvermeidlichen Arbeitsalltag gehören.
Stille für Erfolgreiche
Was viele Arbeitgeber nicht verstehen wollen: Für komplexe Denkaufgaben ist das Homeoffice oft tatsächlich das Produktivitätsparadies. Ich habe das immer gepredigt, aber so recht wollte mir das niemand abnehmen – weder Vorgesetzte noch die Dame von der Postzustellung! Letztere kam immer so gerne an meinem Schreibtisch vorbeigeschlendert und fragte mich, ob ich schon gehört habe, dass Thorsten und Sabine aus dem Marketing jetzt »eine Sache« haben.
Keine spontanen »kurzen Fragen«, die sich zu halbstündigen Diskussionen auswachsen. Keine Lärmkulisse aus Telefonaten, Drucker-Geräuschen und dem charakteristischen Klicken der Tastatur von Herrn Müller, der offenbar glaubt, sein Keyboard mit der Kraft eines Schmiedehammers bearbeiten zu müssen.
Stattdessen: Stille. Konzentration. Die Möglichkeit, tatsächlich in einen Flow-Zustand zu kommen, ohne alle zehn Minuten herausgerissen zu werden, weil jemand meint, seine neuesten Wochenend-Eskapaden akustisch mit der gesamten Belegschaft teilen zu müssen.
Die Homeoffice-Heiligen
Ein besonderes Phänomen der Homeoffice-Ära ist das, was ich das »Messias-Syndrom« nenne: Die fast religiöse Überzeugung mancher Heimarbeiter, dass sie die einzigen sind, die tatsächlich produktiv sind, während alle anderen vermutlich die Beine im 180-Grad-Winkel nach oben gelegt haben.
»Ich arbeite natürlich den ganzen Tag konzentriert«, denkt der durchschnittliche Heimarbeiter, »aber meine Kollegen? Die sitzen sicher in der Sonne und trinken Aperol Spritz!« Diese seltsame kognitive Dissonanz – die Gewissheit über die eigene Tugendhaftigkeit bei gleichzeitiger Skepsis gegenüber allen anderen – ist ein faszinierendes psychologisches Phänomen.
Passive Aggressivität
In Meetings manifestiert sich dieses Syndrom durch passive Aggression: »Oh, schön, dass du Zeit gefunden hast, an unserem Call teilzunehmen, Thomas!« – eine Bemerkung, die unterschwellig kommuniziert: »Ich vermute, du warst die letzten zwei Stunden beim Friseur, während ich hier im Schweiße meines Angesichts schuffte.«
Gemeinsam einsam
Eine besondere Ironie des digitalisierten Arbeitens liegt in der gleichzeitigen Förderung von Teamarbeit und Vereinzelung. Nie zuvor war es so einfach, mit 20 Personen gleichzeitig an einem Dokument zu arbeiten – und sich dennoch vollkommen allein zu fühlen.
Die moderne Arbeitswelt preist »Kollaboration« als höchsten Wert, während sie gleichzeitig Strukturen schafft, in denen jeder isoliert vor seinem Bildschirm sitzt. Ein kollaboratives Einzelkämpfertum, bei dem alle zusammen – aber jeder für sich – in digitalen Dokumenten herumtippen.
»Lasst uns asynchron zusammenarbeiten!« – ein Satz, der übersetzt bedeutet: »Ich möchte nicht mit euch reden müssen, aber trotzdem so tun, als wären wir ein Team.«
Die Kommunikations-Paradoxie
Apropos Kommunikation – die hat im Homeoffice eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Während im Büro ein kurzer Zuruf über den Schreibtisch genügte, muss nun ein formeller Termin vereinbart werden. »Hast du kurz Zeit für einen Call?« ist die neue Formulierung für »Ich hätte eine Frage, die in 30 Sekunden beantwortet wäre, aber jetzt darfst du dich gleich 15 Minuten lang mit mir beschäftigen.«
Ich habe mal in einem Projektteam zusammengearbeitet, bei dem die Kommunikation so kompliziert wurde, dass wir uns schließlich in einer surrealen Situation wiederfanden: Fünf Personen verbrachten drei Stunden in einem Videocall, um zu besprechen, wie wir künftig effektiver kommunizieren könnten. Das Ergebnis? Wir brauchen mehr regelmäßige Calls. Und jetzt bitte nicht lachen – das ist mir wirklich so passiert!
Der wahre Kostensparer
Wollen wir doch mal ehrlich sein: Ein nicht unerheblicher Teil der plötzlichen Begeisterung mancher Unternehmen für flexibles Arbeiten basiert auf simplem Kalkül. Homeoffice bedeutet weniger Bürofläche, geringere Nebenkosten, kein teures Kantinenessen, das subventioniert werden muss.
»Wir haben bei dieser Entscheidung ausschließlich das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter im Blick«, beteuert die Geschäftsführung nach außen. Zeitgleich kalkuliert der Facility Manager bereits die Kostenersparnis durch die Einführung des beschönigend als »Desk-Sharing« bezeichneten Systems – ein Konzept, das den Mitarbeitern zwar die Anwesenheit erlaubt, ihnen aber keinen eigenen Arbeitsplatz mehr zusichert.
Hybrides Zukunftsmodell
Die Ironie der Homeoffice-Debatte liegt darin, dass beide Seiten – Arbeitgeber wie Arbeitnehmer – oft aneinander vorbeireden. Während Chefs befürchten, ihre Angestellten könnten zu Hause in einen Tiefschlaf verfallen, sorgen sich Mitarbeiter, für nicht ausreichend produktiv gehalten zu werden, und arbeiten deshalb mehr als nötig.
Die Zukunft der Arbeit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte: Ein hybrides Modell, das die Vorteile beider Welten vereint. Zwei Tage im Büro für Meetings, Teambuilding und das rituelle Vernichten von Geburtstagskuchen. Drei Tage zu Hause für konzentriertes Arbeiten, produktive Ruhe und die Möglichkeit, zwischendurch die Spülmaschine auszuräumen, ohne dafür gleich an den Pranger gestellt zu werden.
Das grenzenlose Arbeiten
Ein weiteres Phänomen, das im Homeoffice-Zeitalter besonders ausgeprägt ist: die schleichende Auflösung der Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben. Früher war klar – wer im Büro ist, arbeitet; wer zu Hause ist, hat Feierabend. Heute greift man »nur schnell« um 22 Uhr noch einmal die E-Mails ab oder beantwortet »ganz kurz« am Samstagvormittag eine Anfrage.
Ich ertappte mich vor einigen Jahren dabei, wie ich während einer Grillparty mit Freunden »mal eben« eine dienstliche E-Mail las. Als ich aufsah, blickten mich drei Paar vorwurfsvolle Augen an. »Ist das dein Ernst?«, wurde ich gefragt. Ein einschlägiger Moment, danach legte ich mir ein separates Diensthandy zu.
Dresscode: Chaosprinzip
Nicht zu unterschätzen: die modische Revolution, die das Homeoffice eingeleitet hat. Der heutige Arbeits-Dresscode folgt dem Prinzip »Business oben, Party unten« – präsentabel gekleidet von der Gürtellinie aufwärts (für Videokonferenzen), kombiniert mit Jogginghose oder gar Schlafanzughose unterhalb des Sichtfelds der Kamera.
Ich kenne jemanden, der die Kunst perfektioniert hat… innerhalb von 30 Sekunden vom Look »gerade aufgestanden« zum Look »kompetenter Businessmensch« zu wechseln – eine Fähigkeit, die sich in keinem Lebenslauf verewigen lässt, aber erstaunlich nützlich ist, wenn der Chef spontan zum Videocall lädt.
Neue Arbeitswertung
Vielleicht ist das Homeoffice auch einfach der überfällige Katalysator für eine grundlegende Neubewertung dessen, was Arbeit eigentlich bedeutet. In einer Wissensgesellschaft, in der Denken und Kreativität die Hauptwährungen sind, ist es ohnehin absurd, Leistung an Anwesenheit zu messen.
Ironischerweise zeigt die Homeoffice-Erfahrung, dass viele Menschen nicht weniger, sondern mehr arbeiten, wenn sie zu Hause sind – aus Angst, als faul zu gelten. Die befürchtete Faulheit entpuppt sich als das genaue Gegenteil: eine neue Form der Selbstausbeutung.
Evolutionärer Wendepunkt
Vielleicht werden wir uns in einigen Jahren nostalgisch an die Zeit erinnern, als »Arbeiten« noch bedeutete, morgens aus dem Haus zu gehen und abends zurückzukehren – so wie wir heute mit Verwunderung auf die Zeit zurückblicken, als Rauchen im Büro noch normal war oder Sekretärinnen für ihre Vorgesetzten Kaffee kochen mussten.
Oder aber das Pendel schwingt zurück, und der nächste große Trend wird das »Neo-Büro« sein – ein Ort, an dem Menschen freiwillig zusammenkommen, um gemeinsam zu arbeiten, allerdings mit mehr Freiheit und weniger Kontrolle als in der Vor-Homeoffice-Ära.
Arbeit neu denken
Am Ende ist die Debatte über Homeoffice vs. Büro vielleicht nur ein Symptom einer viel größeren gesellschaftlichen Frage: Was bedeutet »Arbeit« eigentlich in einer Zeit, in der immer mehr davon im virtuellen Raum stattfindet?
Ist jemand, der acht Stunden konzentriert am Küchentisch an Programmen schreibt, weniger »bei der Arbeit« als jemand, der die gleiche Zeit im Büro verbringt, aber regelmäßig von Kollegen und Meetings unterbrochen wird?
Die protestantische Arbeitsethik, die in unserer Gesellschaft noch immer tief verwurzelt ist, misstraut der Bequemlichkeit. Arbeit soll anstrengend sein, sichtbar, möglichst mit einem Element des Leidens verbunden. Die Vorstellung, dass jemand in bequemer Kleidung auf seinem Sofa sitzend wertvolle Arbeit leisten könnte, widerstrebt unserem kollektiven Verständnis davon, was »richtige Arbeit« ist.
Mein Fazit
Die Qualität der Arbeit hängt nicht davon ab, wo oder wie sie erledigt wird, sondern davon, was am Ende dabei herauskommt. Ob im Anzug oder in Jogginghose, im Großraumbüro oder am Küchentisch – gute Arbeit ist gute Arbeit.
Übrigens: Diese Zeilen wurden in bequemer Jogginghose verfasst, während ich genüsslich an meinem Kaffee nippte und hin und wieder in die einladenden Sonnenstrahlen blinzelte. Die Produktivität hat offensichtlich nicht gelitten – oder doch?
© Ron Vollandt | Rons famose Gedankenwelt
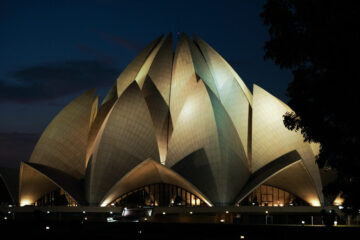


0 Kommentare